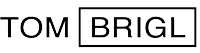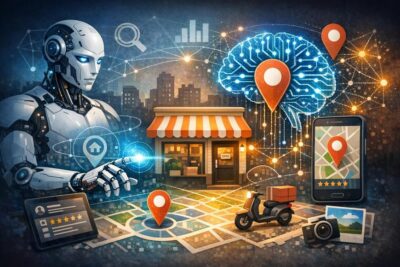Wenn du mit Webseiten arbeitest, die in mehreren Ländern oder Sprachen sichtbar sein sollen, stolperst du früher oder später über das Thema hreflang-Tags. Genau genommen ist das ein unscheinbares kleines Attribut im Code, das aber große Auswirkungen haben kann. Es entscheidet oft darüber, ob Nutzer aus Spanien auch die spanische Version deiner Seite zu Gesicht bekommen – oder ob sie ungewollt auf der US-Seite landen und diese dann vielleicht sogar mit einem Schulterzucken wieder verlassen.
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir sagen: Das Thema wirkt am Anfang erstaunlich trivial, aber in der Praxis merkt man schnell, wie viele Stolpersteine es gibt. Und kaum jemand schafft es, beim ersten Mal ganz sauber zu bleiben.
Warum hreflang überhaupt wichtig ist
Stell dir vor, du betreibst einen Onlineshop für Mode. Du hast im Prinzip denselben Katalog, aber die Preise, Größenangaben und manchmal auch die Tonalität der Texte unterscheiden sich: In den USA sprichst du von „sweaters“, in UK von „jumpers“. Ohne hreflang könnte Google oder Bing einfach irgendeine Seite ausspielen. Vielleicht sehen deutsche Nutzer dann deine österreichische Seite mit Euro-Preisen, oder Franzosen landen auf Englisch. Das zerstört Vertrauen, und du wirst mögliche Verkäufe verlieren.
Mit hreflang gibst du den Suchmaschinen einen klaren Hinweis: „Diese Version gehört zu Deutschland, diese zu Frankreich. Spiel bitte die richtige aus.“
Wie ein Tag aufgebaut ist
Die Struktur ist eigentlich simpel: Du verknüpfst Seiten miteinander und gibst mit ISO-Sprach- und Länder-Codes an, welche Sprachvariante wofür gedacht ist. Ganz grob brauchst du:
- Ein rel=“alternate“, um den Zusammenhang zu signalisieren,
- Ein hreflang, das den Sprach-/Landescode enthält (z.B. en-gb oder de-de),
- Und natürlich die korrekte URL im href-Feld.
Dabei solltest du beachten: Jede Seite sollte auch sich selbst referenzieren. Und: Die Referenzen müssen immer in beide Richtungen existieren. Also wenn die DE-Seite auf die UK-Seite verweist, muss die UK-Seite auch zurück auf die DE-Seite verweisen. Es ist wie ein Händedruck – einer allein reicht nicht, um Vertrauen aufzubauen.
Die häufigsten Fehler
Falsche oder fehlende Rückverweise
Ein Klassiker: Du setzt auf deiner US-Seite einen Link zur UK-Seite, vergisst aber, auf der UK-Seite wieder zurück zur US-Version zu zeigen. Damit brichst du die wechselseitige Logik, und Google könnte durcheinanderkommen. Ich habe das zigmal bei Audits gesehen.
Ungültige Sprach- oder Ländercodes
Noch schlimmer: Du nutzt Codes, die es so gar nicht gibt. Ein gern gemachter Fehler ist en-uk. Klingt logisch, ist aber falsch. Richtig heißt es en-gb. Hier lohnt es sich wirklich, die ISO-Listen einmal abzuspeichern oder regelmäßig nachzuschlagen. Denn ein kleiner Tippfehler entwertet das ganze Tag.
Widersprüche mit Canonical oder Noindex
Vielleicht hast du auf der Seite ein Canonical, das woanders hinzeigt – während hreflang versucht, eine andere Beziehung herzustellen. Oder die hreflang-URL ist eigentlich ein 404. Solche Widersprüche ziehen den Teppich unter deinen Füßen weg. Suchmaschinen sind dann unsicher, und meistens verliert deine Seite Sichtbarkeit. Wenn Canonical und hreflang sich widersprechen, respektiert Google eher das Canonical. Und schon ist die schöne hreflang-Logik dahin.
Unvollständige Verzeichnisse
Ein weiterer Fehler: Du hast fünf Sprachversionen deiner Startseite, aber im hreflang fehlen zwei davon. Das Ergebnis: Google begreift die Zusammengehörigkeit nicht vollständig. Ich sage oft: Halbe Arbeit beim hreflang ist verschenkte Arbeit.
Missbrauch von x-default
Die x-default-Version dient als „Auffangnetz“, wenn für den Nutzer keine spezifische Sprachversion passt. Manche setzen sie falsch ein, beispielsweise als deutsche Version. Dabei sollte x-default auf einer neutralen Eingangsseite liegen, wo Nutzer die Sprache selbst auswählen können. Sonst interpretieren Suchmaschinen deine Signale falsch und zeigen in Märkten Inhalte aus, die gar nicht passen.
Nicht nur die Tags zählen
Manchmal sind die hreflang-Tags korrekt, und trotzdem stimmt etwas nicht. Warum? Weil die Struktur deiner Seite oder das Rendering Probleme verursacht.
Ein Beispiel: Manche Webseiten „übersetzen“ Inhalte erst mit JavaScript, wenn ein Nutzer im Browser die Seite lädt. Google sieht aber nur die Ausgangssprache, nicht das austauschte Snippet. Ergebnis: Der Content bleibt im falschen Index. Auch gemischte Sprachen sind riskant: Menü auf Englisch, Content auf Spanisch – das wirkt lieblos und wird oft von Nutzern wie auch Suchmaschinen abgewertet.
Was du beim Audit tun kannst
Analytics prüfen
Schau dir an, ob die Nutzer aus dem jeweils erwarteten Land auch auf der richtigen Seite landen. Wenn 90 % der Briten auf der US-Seite aufschlagen, stimmt etwas nicht. Dann kannst du gezielt prüfen, wo es im hreflang hakt.
Stichprobe von Seiten nehmen
Ich würde nicht sofort die ganze Website auditen, sondern einzelne Schlüssel-Seiten. Funktioniert das Prinzip dort, kannst du dich weiter durch arbeiten. Jede Seite sollte sich selbst listen und die Partnerseiten nennen – konsequent und bidirektional.
XML-Sitemap gegen den Quellcode testen
Viele Websites tragen hreflang in die Sitemaps ein. Andere direkt in den Kopfbereich des HTML. Problematisch wird es, wenn beides passiert – und die Angaben nicht übereinstimmen. Entscheide dich für eine Methode und bleib konsistent. Damit vermeidest du ein Chaos, das schwer zu diagnostizieren ist.
Tools nutzen
Natürlich gibt es diverse Tools, die dein Setup prüfen. Crawler wie Screaming Frog oder spezielle hreflang-Checker können helfen, Tippfehler, fehlende Rücklinks oder falsche Statuscodes aufzuspüren. Ich halte das für unverzichtbar, sobald du mehr als nur eine Handvoll Sprachen pflegst.
Meine persönliche Beobachtung
Eigentlich ist hreflang eine der typischen SEO-Dinge, die kein normaler Nutzer jemals zu Gesicht bekommt. Aber wehe, sie laufen schief: Plötzlich wundern sich die Leute, warum ihre Seite in Frankreich nicht rankt, oder warum ein spanischsprachiger Kunde Preise in Dollar sieht. Mir ist aufgefallen: Viele Unternehmen behandeln hreflang wie einen „Luxus“, den man später macht. In Wahrheit sollte man ihn gleich im Setup berücksichtigen, sonst flickt man jahrelang herum.
Und noch ein Punkt: hreflang ist nur ein Hinweis für Suchmaschinen, kein Befehl. Das heißt, selbst bei perfektem Code ist es möglich, dass Google manchmal eine andere Relevanzentscheidung trifft. Oft hilft es dann, die allgemeinen Signale – Sprache im Content, Domain-Endung, interne Verlinkung – klar auszuspielen.
Fazit
Wenn du international tätig bist, kommst du an hreflang nicht vorbei. Achte darauf, dass deine Tags valide, bidirektional, vollständig und widerspruchsfrei sind. Prüfe regelmäßig deine Sitemaps und Page-Head-Angaben, beobachte dein Analytics und setze Tools ein.
Aber: Vergiss nicht, dass eine klar strukturierte Website mit sauber übersetzten Inhalten die eigentliche Basis ist. Hreflang ist ein Signal, aber er ersetzt keine klare Seitenarchitektur und schon gar nicht eine gute User Experience.
Im Endeffekt gilt: Du kannst noch so viel am Code optimieren – wenn dein französischer Nutzer plötzlich auf einer halben Englisch/halben Französisch-Seite landet, wird er trotzdem abspringen. Suchmaschinen erkennen solche Schwächen erstaunlich schnell.