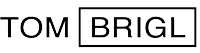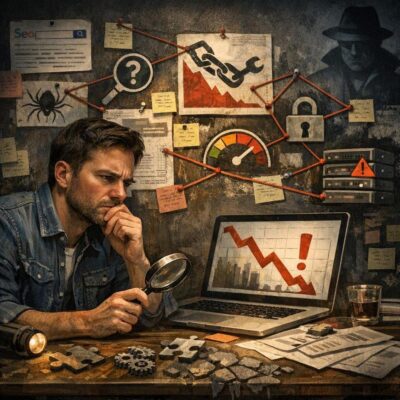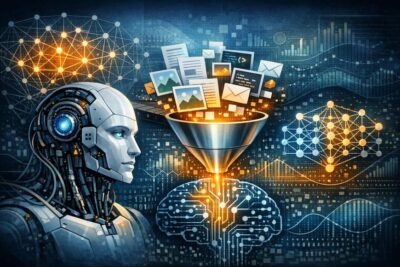Manchmal bringt mich die digitale Welt wirklich zum Staunen. Da entwickelt ein Tech-Gigant ein Werkzeug, das eigentlich helfen soll, qualitativ hochwertige Inhalte sichtbarer zu machen – und was passiert? Es wird von Spam und dubiosen Domains überflutet. Genau das habe ich erlebt, als ich näher hinschaute, wie Googles neue Funktion zur Auswahl bevorzugter Nachrichtenquellen („Preferred Sources“) in der Praxis funktioniert.
Die Idee hinter Googles „Preferred Sources“
Eigentlich klingt die Idee sympathisch: Du kannst selbst entscheiden, welche Nachrichtenquellen du in Googles „Top Stories“ häufiger sehen möchtest. Diese Funktion richtet sich an alle, die personalisierte Nachrichtenfeeds schätzen und bekannte, vertrauenswürdige Medien bevorzugen. Du gehst in die Einstellungen, gibst eine Domain oder Publikation ein, die du gerne liest, und Google merkt sich das als deine bevorzugte Quelle. Das Ziel: mehr Kontrolle, weniger Zufall.
So weit, so gut. Zumindest in der Theorie. In der Praxis passiert aber etwas, das Kopfschütteln verursacht: Statt anerkannte Medienunternehmen werden dubiose Webseiten – teils mit eindeutig spamartigen Mustern – vorgeschlagen. Domains, bei denen nur die Startseite überhaupt im Index auftaucht, werden plötzlich als „Preferred Source“ angezeigt. Manche davon sind nichts anderes als geparkte Domains oder billige Nachahmungen bekannter Portale.
Wie diese Kopien entstehen
Ich habe etwas genauer hingesehen. Viele dieser zwielichtigen Domains scheinen Varianten bekannter Seiten zu sein – sogenannte Copycat-Domains. Das Phänomen ist alt: Jemand registriert einen Domainnamen, der fast identisch mit einer bekannten Marke ist, nutzt aber eine andere Endung (TLD). Wenn also „großewebsite.com“ bereits vergeben ist, sichern sich diese Leute Adressen wie großewebsite.com.in oder großewebsite.net.in. Das ergibt URLs, die auf den ersten Blick seriös wirken, in Wirklichkeit aber kaum oder gar keinen legitimen Inhalt bieten.
Solche Domains werden dann anscheinend in Googles System aufgenommen. An welcher Stelle und wie das passiert, lässt sich aktuell schwer sagen. Möglich ist, dass Nutzer sie selbst hinzufügen. Vielleicht zieht Google sie aber auch automatisiert aus bestimmten Datenquellen. Sicher ist nur: So, wie es derzeit aussieht, ist das System anfällig für Missbrauch.
Ein paar erstaunliche Beispiele
Ein Beispiel, das mir besonders auffiel: Bei einer Suche nach einem bekannten SEO-Tool schlug das „Preferred Sources“-Tool neben der echten Domain auch eine Parkdomain im indischen .com.in-Bereich vor. Die Seite selbst ist leer, es werden nur Werbelinks angezeigt. Ähnlich verhält es sich mit vermeintlichen „Spiegeln“ großer Medien: Die „New York Times“ scheint ebenfalls eine gefälschte .in-Version in der Liste zu haben. Und selbst bei HuffPost taucht eine indische Domain auf, die sich als seriöse Nachrichtenquelle ausgibt – aber tatsächlich über dubiose Themen wie Kredite und Luxusuhren berichtet.
Ein kurzer Blick in den Index zeigt dann die Wahrheit: Die Seite ist kaum indexiert, meist nur mit der Startseite vertreten – ein klassisches Zeichen für Spam oder Keyword-Farming. In manchen Fällen weisen diese Seiten sogar Links zu zwielichtigen Angeboten auf. Es ist schwer zu glauben, dass solche Websites durch normale Überprüfungsschritte in ein Tool geraten, das Nutzern helfen soll, Qualität zu priorisieren.
Ein pikantes Detail
Ironischerweise ist selbst eine Kopie von Search Engine Journal in diesem Tool gelistet – mit einer .in-Endung. Das zeigt, dass offenbar niemand vor solchen Klonen sicher ist. Für die betroffenen Marken ist das mehr als nur ärgerlich: Es kann langfristig zu Verwirrung führen und das Vertrauen der Nutzer untergraben.
Wie kann das passieren?
Genau das ist die Frage, die mir nicht aus dem Kopf geht. Es gibt verschiedene Hypothesen. Eine lautet, dass Spammer gezielt versuchen, ihre Domains als „Preferred Sources“ einzutragen, um so Autorität zu erschleichen. Wenn Nutzer oder automatisierte Systeme dann diese Domains in den Empfehlungen sehen, gewinnen sie Klicks und vielleicht sogar einen Hauch von Glaubwürdigkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass Google selbst bei der Datenaggregation schlicht zu ungenau vorgeht. Vielleicht fehlen Filter, um Qualitätsmerkmale richtig zu erkennen, oder es gibt schlicht kein Prüfverfahren für eingereichte Domains.
Interessant ist auch, dass dieses Tool derzeit nur in den USA und Indien verfügbar ist. Das könnte erklären, warum besonders viele indische Domains auftauchen. Aber auch dann bleibt die Frage: Warum erscheinen diese Seiten überhaupt bei einer globalen Suchanfrage nach etablierten Marken?
Ein strukturelles Problem?
Wenn man ehrlich ist, wundert es nicht: Personalisierungsfunktionen, die Nutzern mehr Einfluss geben sollen, werden fast immer von Manipulatoren ausgetestet. Wer sich in der Suchmaschinenoptimierung auskennt, weiß, dass jede neue Google-Funktion innerhalb von Tagen auf Schwachstellen untersucht wird. Sobald klar wird, dass das Hinzufügen einer Domain relativ unkontrolliert möglich ist, öffnet sich eine Tür für Trittbrettfahrer.
Aus meiner Sicht liegt hier ein klassischer Zielkonflikt vor: Google möchte Nutzerbeteiligung und Transparenz fördern – aber gleichzeitig Missbrauch verhindern. Ohne klare Authentifizierungsmechanismen oder manuelle Überprüfung ist so ein Tool jedoch leicht manipulierbar.
Die Verantwortung der Marke – und von Google
Wenn du eine Marke führst, solltest du unbedingt prüfen, ob dein Domainname missbraucht wird. Gerade in Regionen mit offenen Domain-Endungen wie .in oder .ai kann jeder schnell eine ähnliche Adresse registrieren. Es lohnt sich, regelmäßig zu überprüfen, welche Varianten deines Namens existieren – und ob sie in Tools wie „Preferred Sources“ oder sogar in den Suchergebnissen auftauchen.
Für Google ist das Ganze heikel. Das Unternehmen wirbt damit, „hohe Qualität“ und „Vertrauen“ zu priorisieren. Wenn ausgerechnet das eigene Personalisierungssystem Spamseiten hervorhebt, untergräbt das diese Botschaft. Gerade in Zeiten, in denen Desinformation und digitale Manipulation ohnehin ein drängendes Problem sind, kann man solche Fehltritte kaum als nebensächlich abtun.
Echtes Vertrauen entsteht durch Kontrolle
Die ironische Wahrheit ist: Indem Google den Nutzern Kontrolle geben wollte, hat es ein neues Kontrollproblem geschaffen. Es braucht dringend eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass nur legitime, verifizierte Quellen eingetragen werden – etwa über strukturierte Publisher-Daten, registrierte G-News-Profile oder offizielle Domain-Verifizierung (ähnlich wie bei Search Console). Ohne das wird das Feature kaum langfristig bestehen können.
Mein persönliches Fazit
Ich finde das ganze Thema symptomatisch für das, was aktuell in der Suchwelt passiert. Automatisierung, Personalisierung und Geschwindigkeit stehen im Vordergrund – aber der menschliche Blick für Plausibilität fehlt oft. Das „Preferred Sources“-Tool ist im Kern eine gute Idee: Nutzer sollen ihre Lieblingsquellen stärker gewichten können. Doch ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen verwandelt sich dieses Konzept in ein Einfallstor für Spam und Markenmissbrauch.
Mich erinnert das an frühere Google-Experimente mit Community- oder Feedback-Features, die ebenfalls nach kurzer Zeit mit Falschinformationen oder Manipulation überflutet wurden. Der Grat zwischen Offenheit und Chaos ist schmal. Vielleicht braucht es wieder etwas mehr „digitales Hausmeistertum“ – weniger Automatik, mehr sorgfältige Kuratierung.
Bis dahin kann ich dir nur raten: Wenn du das Tool nutzt, prüfe genau, welche Domains du auswählst. Achte auf Schreibweisen, auf Domainendungen, auf die tatsächlichen Inhalte. Und wenn du eine bekannte Marke betreibst – überprüfe gelegentlich, ob jemand deinen Namen auf zweifelhafte Weise nutzt. Im Internet gilt leider immer noch: Vertrauen entsteht nicht durch Algorithmen, sondern durch Kontrolle und Aufmerksamkeit.