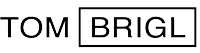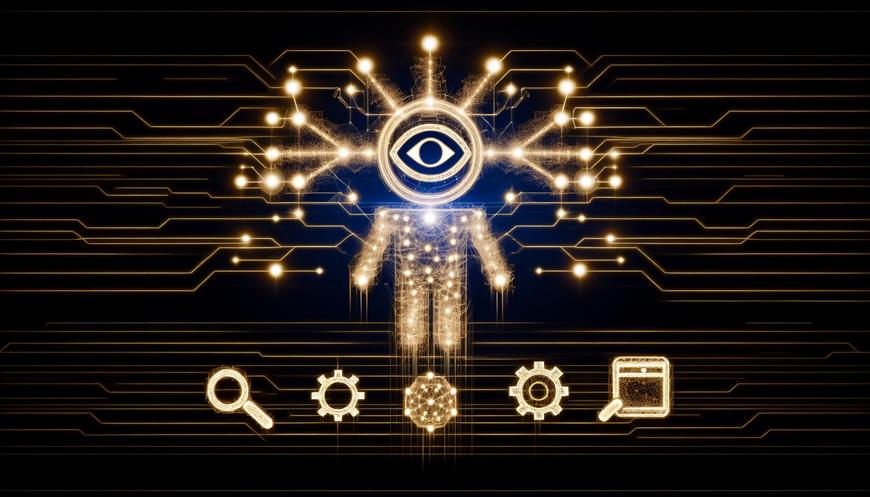Ich habe in den letzten Monaten intensiv beobachtet, wie sich Suchmaschinen verändern – konkret durch den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Art, wie Menschen suchen und auf Suchergebnisse reagieren. Dabei ist mir eines immer klarer geworden: Wir stehen am Anfang eines Umbruchs, bei dem klassische organische Suchergebnisse an Bedeutung verlieren und stattdessen AI‑gestützte Interfaces übernehmen. Die folgende Analyse ist das Ergebnis einer Auswertung von zehn verschiedenen Studien, Nutzertests und Datenquellen rund um das Thema „AI Mode“ – also jener neuen Google‑Suchfunktion, in der Antworten generativ zusammengestellt werden, statt ausschließlich über Links auf Websites zu verweisen.
Der dramatische Einbruch der Klicks
Wenn man die verschiedenen Datensätze nebeneinanderlegt, zeigt sich ein eindeutiges Muster: AI Mode reduziert externe Klicks drastisch. Dazu muss man wissen, dass Google durch diesen Modus versucht, komplette Antworten im Interface selbst bereitzustellen. Studien von Semrush, Clickstream und Propellic belegen übereinstimmend, dass zwischen 90 und 95 % der Sessions gar keine externen Klicks mehr erzeugen.
Das bedeutet: Selbst wenn Nutzer eine Anfrage starten, bleiben sie oft vollständig in Googles Antwort‑Ansicht. Nur noch bei klaren Kauf‑ oder Buchungsabsichten findet ein Absprung zu externen Seiten statt. In sogenannten „Shopping‑Prompts“ liegt die Klickrate fast bei hundert Prozent, während informationelle oder explorative Fragen häufig völlig ohne Linkklick abgeschlossen werden. Session‑Längen verkürzen sich auf zwei bis drei Suchanfragen pro Besuch – früher waren es im Schnitt fünf.
Für SEO‑Teams ist das ein Wendepunkt. Sichtbarkeit bleibt zwar wichtig, doch das Erfolgsmaß verändert sich. CTR verliert an Aussagekraft. Stattdessen zählen Metriken wie Erwähnungen im AI‑Text, Brand‑Recall oder Verweildauer in den Antworten. Erstmals wird Markenwirkung innerhalb des Google‑Interfaces mess‑ und entscheidend.
Warum sich Nutzer mit AI Mode schwertun
Parallel zu diesen quantitativen Rückgängen fällt auf, dass die Adoption des neuen Modus stockt. Mehrere Nutzertests – etwa von iPullRank – zeigen, dass aktuell nur zwei bis fünf Prozent der Suchenden die Funktion aktiv nutzen. Viele finden den Button, klicken kurz hinein und springen dann zu klassischen Ergebnissen zurück. Über die Hälfte der Erstnutzer probierte den Modus genau einmal. Danach blieb er ungenutzt.
Das liegt zum Teil an der Unsicherheit gegenüber generativen Antworten. Einige Menschen empfinden die Präsentation als unübersichtlich oder sind sich nicht sicher, ob die Informationen aktuell und vertrauenswürdig sind. Viele verwechseln AI Mode mit den sogenannten „AI Overviews“, also jenen automatisch eingeblendeten Snippets, die weiter oben in den Suchergebnissen erscheinen. Zusätzlich beobachten Psychologen in den Studien: Je stärker Nutzer routiniert mit der klassischen Suche vertraut sind, desto mehr lehnen sie den Modus zunächst ab.
Google überlässt diese Skepsis allerdings nicht dem Zufall. Seit Sommer werden AI‑Funktionen sukzessive auch in Chrome, im Assistant und in mobilen Suchoberflächen integriert. Unternehmensvertreter sprachen öffentlich davon, dass es mittelfristig das „Standard‑Sucherlebnis“ werden soll. Ob das so kommt, hängt letztlich davon ab, ob Google es schafft, Vertrauen und Nutzen gleichzeitig zu steigern.
Trefferqualität: Zwischen Vertrauen und Halluzination
Die Qualität der generierten Antworten ist ein weiteres sensibles Thema. Viele Tester bestätigten zwar, dass AI Mode schnell und gut strukturiert reagiert. Besonders bei planenden oder beschreibenden Suchaufgaben – etwa Reisen, Produktvergleiche oder Bildungsthemen – bewerteten Probanden die Ergebnisse mit 4,3 von 5 Punkten. Sie lobten Klarheit und Übersicht.
Andererseits tauchen Fehler immer wieder auf. Bei lokalen News oder spezifischen medizinischen Fragen enthielten die Antworten teilweise veraltete oder ungenaue Angaben. Manche Nutzer gingen ohnehin nicht davon aus, dass AI‑basierte Systeme tagesaktuell sind – ein gefährliches Vorurteil, das Vertrauen durch Gewöhnung ersetzt.
Kleinere Feldexperimente, etwa eines von Ahrefs, belegten zudem, dass selbst Google‑AI‑Texte nicht automatisch SEO‑tauglich sind. Drei maschinell generierte Artikel zu technischen Themen landeten für ihre Zielbegriffe gar nicht im Index. Das spricht dafür, dass Googles eigene Qualitätskriterien (EEAT) strenger sind als das, was AI Mode momentan produziert.
AI Mode vs. AI Overviews
Beide Funktionen verfolgen das gleiche Prinzip – Zusammenfassung statt Liste – unterscheiden sich aber deutlich im Verhalten der Nutzer. Overviews werden inline angezeigt, AI Mode öffnet sich als separater Chat‑Bereich. Während Overviews wie ein schneller Informationsblock funktionieren, lädt AI Mode zum tiefen, dialogischen Erkunden ein.
Dwell‑Time‑Messungen ergaben, dass Menschen im Modus etwa doppelt so lange verweilen wie in Overviews. Sie scrollen durch, klicken auf Pfeile, lesen Zitate. Auf der anderen Seite ist Verwirrung allgegenwärtig: In Usability‑Tests bemerkte mehr als die Hälfte der Teilnehmenden gar nicht, dass sie zwischen zwei unterschiedlichen Produkten navigieren.
Auch die Quellenlage ist komplexer: Während Overviews meist drei bis vier Domains verlinken, zitiert AI Mode im Schnitt sieben bis zwölf, häufig direkt als Inline‑Link im Fließtext. Das führt zu minimaler, aber gleichmäßigerer Sichtbarkeit für Marken innerhalb der Antwort. Nur etwa 10 Prozent der Quellen tauchen in beiden Formaten gleichzeitig auf – man kann also nicht automatisch davon ausgehen, dass Rankingfaktoren identisch sind.
Markenwirkung trotz null Klicks
Bleibt die entscheidende Frage: Wenn niemand mehr klickt – lohnt sich die Mühe überhaupt?
Alle mir bekannten Studien deuten auf einen klaren „Ja, aber“. Menschen nehmen Marken wahr, selbst wenn sie die Seite nicht öffnen. In der Untersuchung von Propellic lasen die Nutzer im Schnitt über hundert Sekunden innerhalb eines generierten Planungsdialogs und merkten sich dabei bekannte Unternehmensnamen. Später, bei tatsächlichen Kaufentscheidungen, griffen sie auf diese Erinnerungen zurück.
Auch im eigenen Verhaltenstest fiel auf, dass Vertrauen stärker wirkt als Position. Bekannte Marken wurden wiederholt gewählt, selbst wenn Alternativen höher oder prominenter genannt waren. Der Mechanismus ähnelt klassischer Markenwerbung: Präsenz schafft Präferenz.
Darum sollte man AI Mode – so paradox es klingt – nicht als Traffic‑, sondern als Branding‑Kanal betrachten. Das Ziel ist nicht der Klick, sondern die Wahrnehmung. Wer es schafft, im Antwort‑Text präsent und positiv konnotiert zu erscheinen, beeinflusst Meinungsbildung unmittelbar dort, wo sie entsteht: im Informationsraum der Suchmaschine selbst.
Was wir noch nicht wissen
Trotz aller Erkenntnisse bleibt die Forschung lückenhaft. Viele Tests liefen nur mit kleinen Stichproben; einige deckten bestimmte Branchen wie Travel oder E‑Commerce ab, während B2B‑ oder Local‑Suchanfragen kaum vorkommen. Außerdem wissen wir wenig darüber, wie sich Sprach‑ und Kulturunterschiede auf das Antwortverhalten auswirken. Noch fehlen Daten zu globalen Rollouts und Mehrsprachigkeit.
Interessant wäre, qualitative Nutzungsbeobachtungen mit massiven Clickstream‑Daten zu kombinieren und dies über Monate hinweg zu wiederholen. Nur so ließe sich belegen, ob sich Gewohnheiten tatsächlich ändern, wenn Google AI Mode schrittweise erzwingt.
Aus meiner eigenen Arbeit mit Unternehmen sehe ich zudem, dass viele Analytics‑Setups die neue Realität nicht erfassen können. Sichtbarkeit in AI Mode ist derzeit technisch kaum messbar. Es gibt keine API, keine eindeutigen Impression‑Signale. Die Branche muss eigene „AI‑Visibility‑Tracker“ entwickeln, ähnlich wie in den Anfangsjahren von SEO. Erst dann werden wir verstehen, wie Markenauftritte in diesen geschlossenen Systemen wirken.
Künftige Strategien für SEOs
1. Sichtbarkeit neu denken
Anstatt rein auf Position 1 zu optimieren, geht es künftig darum, in die Antwort‑Sätze und Quellenlisten zu gelangen. Das gelingt über stark kontextuelle, faktenreiche Inhalte und eine eindeutige Markenidentität – Dinge, die ein LLM zuverlässig zitieren kann.
2. Telemetrie und Beobachtung
Richte Tests ein, die protokollieren, wann dein Brand‑Name in verschiedenen AI‑Tools erscheint. Auch wenn du die Leistung nicht direkt messen kannst, hilft dir die Beobachtung, Trends früh zu erkennen.
3. Vertrauen und Korrektheit
Da Nutzer falsche Informationen kaum bemerken, ist es entscheidend, dass du selbst aktiv überprüfst, was über dich generiert wird. Wer Ungenauigkeiten tolerant hinnimmt, riskiert langfristigen Reputationsschaden.
Ein persönliches Fazit
Ehrlich gesagt: Ich kann nachvollziehen, dass viele Marketer frustriert sind. Nach zwanzig Jahren SEO‑Handwerk erleben wir zum ersten Mal, dass hervorragender Content nicht automatisch zu Klicks führt. Doch ich glaube, dass diese Entwicklung unvermeidlich ist. Suchmaschinen wandeln sich zu Antwort‑Maschinen.
Wenn AI Mode tatsächlich zum Standard wird, verschiebt sich Suchmaschinenoptimierung Richtung Markenkommunikation, Datenqualität und Content‑Engineering. In dieser neuen Ära wird entscheidend sein, wie gut ein Unternehmen seine Informationen strukturiert bereitstellt, damit Maschinen sie einordnen und zitieren können.
Vielleicht ist das gar keine Bedrohung, sondern eine Chance, wieder Qualität vor Quantität zu stellen. Denn eins bleibt: Menschen suchen nach Vertrauen – egal, ob sie eine Linkliste oder eine AI‑Antwort vor sich haben.
Unterm Strich: AI Mode markiert das Ende des alten SEO‑Paradigmas, aber nicht das Ende von Sichtbarkeit. Es verschiebt nur den Ort, an dem Aufmerksamkeit entsteht – weg vom Klick, hin zum Moment des Lesens.