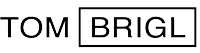In den letzten Monaten ist zwischen Google und europäischen Regulierungsbehörden ein deutlicher Spannungsbogen entstanden. Der Konzern steht im Mittelpunkt einer Untersuchung der Europäischen Kommission, nachdem seine verschärften Anti-Spam-Maßnahmen – insbesondere das Vorgehen gegen sogenanntes Parasite SEO – für Unruhe bei Verlagen gesorgt haben. Google verteidigt diese Schritte vehement und präsentiert sie als notwendigen Schutz für Nutzer und für die Qualität seiner Suchergebnisse. Doch die Geschichte ist komplexer, und sie zeigt, wie unterschiedlich die Interessen von Suchmaschinen, Medienhäusern und Gesetzgebern aufeinanderprallen.
Das grundsätzliche Problem hinter dem Streit
Manchmal vergisst man, wie stark sich die Suchlandschaft verändert hat: Früher konnte fast jede Seite, die halbwegs technisch optimiert war, in den Top-Ergebnissen erscheinen. Heute geht es Google, so sagen sie jedenfalls selbst, vor allem um Vertrauenswürdigkeit und inhaltliche Qualität.
Aber manche Publisher, oft durchaus seriös, nutzen ihre Autorität im Netz, um fremde Inhalte gegen Geld zu veröffentlichen – Inhalte, die auf Traffic und Rankings zielen, nicht auf redaktionelle Relevanz. Genau das fasst der Begriff „Parasite SEO“ zusammen.
Ein klassisches Beispiel ist, wenn ein Nachrichtenportal plötzlich Unterseiten mit Casinowerbung oder Produktvergleichen hostet, die mit seinem regulären Inhalt nichts zu tun haben. Für Google ist das Missbrauch des „Site-Reputationssignals“ – also der Reputation einer etablierten Domain, die jemand anderes nutzt, um besser zu ranken.
Im Frühjahr 2024 hatte Google seine Richtlinien angepasst und die „Site Reputation Abuse Policy“ ins Leben gerufen. Sie soll solche Praktiken eindämmen – zunächst durch manuelle Maßnahmen, inzwischen mit der Perspektive, langfristig auch algorithmisch zu greifen. Für manche Publisher bedeutete das sofort empfindliche Rankingverluste und Einbußen bei den Einnahmen.
Europäische Ermittlungen und was dahinter steckt
Die Europäische Kommission hat unter dem Digital Markets Act (DMA) eine Untersuchung gestartet. Offiziell geht es darum, ob Google mit dieser Policy möglicherweise gegen faire Wettbewerbsbedingungen verstößt und europäische Nachrichtenanbieter diskriminiert. Die Frage lautet: Dürfen Unternehmen, die Inhalte gegen Bezahlung publizieren – also klassische Sponsored Posts oder Advertorials –, von Google im Ranking herabgestuft werden, obwohl sie transparent agieren?
Teresa Ribera, die zuständige EU-Kommissarin, bezeichnete das Vorgehen Googles als potenziell „nicht fair, nicht transparent und möglicherweise diskriminierend gegenüber legitimen Geschäftsmodellen von Publishern“. Hinter diesem Satz steckt eine alte Debatte: Wie weit darf Google definieren, was „gute“ oder „schlechte“ Inhalte sind, wenn gleichzeitig ganze Branchen von dieser Bewertung abhängen?
Dabei ist die Lage durchaus verzwickt. Einerseits wirft man Google regelmäßig vor, zu viele Spamseiten zuzulassen. Andererseits sind viele Medienhäuser angesichts der Werbekrise im Netz auf neue Einnahmewege angewiesen. Sponsoring-Artikel, Affiliate-Modelle oder Content-Partnerschaften sind oft überlebenswichtig. Die EU sieht also nicht nur Google, sondern auch den Zustand des gesamten digitalen Ökosystems im Blickfeld.
Googles Gegenargumente – Verteidigung oder Frontalangriff?
In einem ausführlichen öffentlichen Statement, verfasst vom Google-Chefwissenschaftler für Search, Pandu Nayak, reagierte der Konzern scharf. Er nennt die Ermittlungen „fehlgeleitet“ und betont, dass diese Art von Kritik letztlich Spammern in die Hände spiele. Die Argumentation lautet: Ohne konsequente Durchsetzung hätten betrügerische Akteure leichtes Spiel, sich mit gekauften Platzierungen nach oben zu mogeln – zum Nachteil jener, die mit realem, hochwertigem Content konkurrieren.
Google stützt sich in seiner Verteidigung zudem auf ein Urteil eines deutschen Gerichts, das bereits im gleichen Jahr eine ähnliche Klage abgewiesen hatte. Die Richter bestätigten, dass Googles Richtlinie „rechtmäßig, sachlich gerechtfertigt und konsistent angewendet“ sei. Für Google ist das der Beweis, dass weder Willkür noch Diskriminierung vorliegt.
Die zweite Säule ihrer Argumentation beruht auf dem Nutzerinteresse: Der durchschnittliche Suchende wolle keine Seiten, die lediglich den Zweck verfolgen, Werbelinks oder Kaufempfehlungen zu pushen. Wenn Google seinen Index nicht bereinige, gehe langfristig das Vertrauen verloren, das die Suchmaschine groß gemacht hat.
Interessant ist aber der dritte Punkt, den man fast schon als kommunikativen Schachzug sehen kann: Google behauptet, viele kleine Content-Creator und unabhängige Blogger hätten die Policy begrüßt. Sie fühlten sich nun endlich nicht mehr von großen Portalen verdrängt, die durch ihre „Domainpower“ fremden Content einfließen lassen. Hier definiert sich Google also nicht als Monopolist – sondern als Schützer des fairen Wettbewerbs.
Persönlich betrachtet ist das fast schon ironisch. Denn dieselbe Firma, die in der Vergangenheit wegen Marktdominanz von der EU immer wieder Milliardenstrafen erhielt, präsentiert sich nun als Gleichmacher zwischen „Kleinen und Großen“. Man könnte das zynisch finden – oder als einen strategischen Versuch, das eigene Image zu drehen.
Wie weit darf Google gehen?
Die wesentliche Streitfrage ist: Wo endet legitime Monetarisierung, und wo beginnt Manipulation?
Natürlich hat niemand Interesse an Suchergebnissen, die von irrelevanten Werbeseiten überflutet werden. Aber für viele Medienunternehmen stellt sich das Problem, dass Google kaum unterscheidet, ob ein Artikel kommerziell motiviert ist, solange er formell gegen interne Spam-Indikatoren verstößt.
Gerade im europäischen Mediensektor, wo journalistische Inhalte oft über Kooperationen mit Marken finanziert werden müssen, kann das fatal sein. Es ist eben nicht immer eindeutig: Wenn eine Redaktion eine Produktstudie in Auftrag gibt, die von einer Marke gesponsert wird, ist das dann Spam oder legitime inhaltliche Partnerschaft? Das hängt von Transparenz, Content-Qualität und Absicht ab – drei Faktoren, die ein Algorithmus nur schwer erfassen kann.
Die EU-Kommission scheint jedenfalls der Ansicht zu sein, Google habe in seiner Policy zu wenig Rücksicht auf den unterschiedlichen Kontext genommen. Und diese Einschätzung könnte, wenn sie sich durchsetzt, zu einschneidenden Änderungen führen – nicht nur für Google, sondern auch für seine Richtlinien weltweit.
Manuelle Durchsetzung – Googles derzeitiger Ansatz
Aktuell verlässt sich Google komplett auf manuelle Bewertungen.
Das bedeutet: Teams aus Mitarbeitern prüfen gemeldete Domains und entscheiden, ob ein Verstoß vorliegt. Algorithmische Maßnahmen gibt es bislang offiziell keine, was die Sache zumindest nachvollziehbarer macht.
Im Januar 2025 hat Google seine internen Rating-Guidelines angepasst. Dort findet sich nun die explizite Definition des „Site Reputation Abuse“: Inhalte, die vor allem deshalb auf einer Domain erscheinen, um von deren Autorität im Ranking zu profitieren.
Das zeigt, dass das Thema längst strategisch verankert ist – nicht nur als kurzfristiger Eingriff, sondern als Teil von Googles Verständnis von Content-Integrität.
Die Perspektive der Verlage
Viele Publisher sehen den Fall jedoch ganz anders. Aus ihrer Sicht vermischt Google technische und wirtschaftliche Fragen.
Sie argumentieren: Wenn ein Verlag ein unabhängiges Dossier über eine Marke veröffentlicht, hat das inhaltliche Relevanz – und auch, wenn dafür bezahlt wurde, sollte es nicht pauschal als Spam gelten. Redaktionelle Kontrolle, journalistische Standards und klare Kennzeichnung – das seien legitime Kriterien, um solche Inhalte zuzulassen.
Ein Verleger formulierte einmal sinngemäß: „Google bestraft uns für Revenue-Modelle, die es selbst durch seine Marktstellung notwendig gemacht hat.“
Diese Aussage trifft den Kern vieler Diskussionen. Denn es war die Dominanz der Suchmaschine im Werbemarkt, die Medienunternehmen gezwungen hat, sich neue Einnahmequellen zu suchen.
Und doch – ich muss sagen, aus praktischer SEO-Perspektive wirkt es nachvollziehbar, dass Google versucht, schiefe Systeme zu korrigieren. Manche „Parasitenartikel“ sind offensichtlich: dubiose Kreditanbieter, Casino-Seiten, Wundermittel. Hier gibt es keinen redaktionellen Mehrwert, und solche Inhalte schaden letztlich auch der Glaubwürdigkeit seriöser Plattformen.
Es bleibt nur die Frage, ob Googles Maßnahmen fein genug sind, um die Spreu vom Weizen zu trennen.
Rechtlicher Rahmen und mögliche Konsequenzen
Der Digital Markets Act ist kein Papiertiger. Er erlaubt Bußgelder von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes – das wären im Fall von Google zweistellige Milliardenbeträge.
Das Verfahren läuft deutlich schneller als klassische Kartellverfahren. Demnächst will die Kommission das Beweismaterial auswerten und prüfen, ob Google mit seiner Policy bestimmte Marktteilnehmer benachteiligt oder den Zugang zum Suchindex unfair reguliert.
Google wird darauf reagieren müssen, vermutlich mit einer formellen Stellungnahme und technischen Nachweisen, dass keine Diskriminierung vorliegt. Denkbar ist auch, dass das Unternehmen gezwungen wird, klarere Abgrenzungen oder Beschwerdemechanismen einzuführen – ähnlich wie bei den früheren Shopping- und Android-Fällen.
Wozu das alles führen könnte
Kurzfristig wird der Streit wohl keine spürbare Veränderung für den normalen Nutzer bringen. Die Suchergebnisse in Europa werden nicht plötzlich freier oder gefilterter.
Aber langfristig könnte sich entscheiden, ob Google noch eigenständig festlegen darf, was Qualität bedeutet, oder ob Regulierer stärker eingreifen, um Wettbewerbsinteressen zu schützen.
Das wäre ein Paradigmenwechsel: von einer privaten, algorithmischen Bewertungshoheit hin zu einer teilöffentlichen Kontrolle von Rankingprozessen – eine heikle Balance.
Als jemand, der selbst seit Jahren mit Content- und SEO-Projekten arbeitet, sehe ich beides: den Missbrauch mancher Publisher, aber auch die Machtkonzentration bei Google. Es braucht klare, nachvollziehbare Richtlinien, die legitime Kooperationen ermöglichen und trotzdem Spam verhindern. Doch diese Balance zu finden, ist alles andere als trivial.
Ein möglicher Ausblick
Der Ausgang dieses Verfahrens wird prägend sein – nicht nur für Unternehmen, sondern auch für jede Website, die sich auf organischen Traffic stützt. Sollte die EU Google zum Einlenken zwingen, könnten Publisher mehr Spielraum für bezahlte Inhalte erhalten. Gleichzeitig droht eine Verwässerung der Suchqualität, wenn die Grenzen zwischen redaktionell und werblich weiter verschwimmen.
Googles Position bleibt eindeutig: Die Richtlinie bleibt, denn sie schütze den Nutzer – und ein sauberes Suchergebnis sei letztlich auch im Interesse der Verlage selbst.
Ob Brüssel das genauso sieht, wird sich zeigen. Sicher ist nur, dass der Konflikt das Verhältnis zwischen Suchmaschinenregulierung und Medienfreiheit stärker prägt, als es vielen bewusst ist.
Egal, wie man dazu steht – es zeigt sich, dass in der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie jede technische Regel schnell politische Folgen haben kann. Und zwischen fairer Konkurrenz, verantwortlicher Regulierung und wirtschaftlichem Überleben liegt oft nur ein feiner algorithmischer Strich.