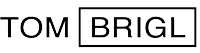Ich habe mir in den letzten Wochen intensiv angesehen, wie sich Google AI Overviews bei Suchanfragen rund ums Einkaufen verändert – und ehrlich gesagt: Es passiert gerade eine Menge. Die neuesten Daten von BrightEdge zeigen ziemlich deutlich, dass Google die Platzierung von AI‑Antworten inzwischen gezielter und strategischer steuert, als viele vielleicht vermuten.
Die Quintessenz: Google zieht seine KI dort zurück, wo sie wenig echten Mehrwert liefert – und setzt sie dort ein, wo Nutzer Orientierung brauchen. Vor allem im Recherche‑ und Vergleichsstadium des Kaufprozesses. Für Marken und Händler bedeutet das: Wer in dieser Phase sichtbar ist, kann über AI Overviews richtig Reichweite gewinnen.
Ein klar gezieltes Muster in den Suchergebnissen
Es fällt auf, dass sich Google in den letzten Monaten nicht einfach nur „vorsichtiger“ zeigt, sondern die KI‑Integration mit System kuratiert. Laut BrightEdge wurden gegenüber einer früheren Erhebungsphase nur etwa 30 % der ursprünglichen AI‑Keywords beibehalten. Spannend dabei: Gerade die Suchbegriffe mit höherem Suchvolumen blieben bestehen – das genaue Gegenteil zum Jahr 2024, als überwiegend kleinere, nischigere Begriffe AI‑Überlagerungen erhielten.
Das deutet darauf hin, dass Google den AI‑Einsatz nicht mehr rein experimentell betreibt, sondern sich genau fragt: „Wo hilft AI dem Nutzer wirklich beim Entscheiden?“ Das Ergebnis: Je erklärungsbedürftiger oder vergleichsintensiver ein Produkt, desto häufiger erscheint dort eine KI‑Übersicht.
Ich habe mir mein eigenes Suchverhalten dazu angesehen – und ja, man sieht es sofort: Bei Suchen wie „beste Kamera für Anfänger“ oder „macbook air vs surface laptop“ blendet Google ausführliche AI‑Boxen ein. Tippt man dagegen „macbook air preis“ ein, verschwindet die KI fast vollständig. Hier überlässt Google lieber den klassischen Suchergebnissen oder den Shopping‑Modulen das Feld.
KI als Vergleichs‑ und Bewertungs‑Schicht
Man kann fast sagen: AI Overviews fungieren als eine Art intelligente Beratungsschicht. Sie greifen dann ein, wenn jemand noch nicht kaufbereit ist, sondern Orientierung sucht. Dabei liefert die KI Zusammenfassungen, verlinkt Quellen und hilft beim Verstehen von Produktunterschieden. Sobald der Nutzer allerdings in den „Ich will kaufen“‑Modus wechselt, hält sie sich wieder zurück.
Diese Trennung ist clever – und ganz im Sinne eines Sucherlebnisses, das User Intent ernst nimmt. Aus SEOsicht bedeutet das, dass man seine Inhalte entsprechend entlang des Kauftrichters aufstellen sollte: erklärende, vergleichende und kontextgebende Inhalte für die oberen Phasen; produkt‑ bzw. transaktionsorientierte Seiten für die finale Entscheidungsphase.
Kategorie‑Spezifik: Wo AI funktioniert – und wo nicht
Die Auswertung zeigt, dass Google die KI nicht gleichmäßig in allen Branchen nutzt. In Kategorien wie Fernseher, Elektro‑Kleingeräte oder Lebensmittel bleibt die AI‑Abdeckung stabil. Nutzer in diesen Bereichen suchen aktiv nach Tipps, Vergleichen oder Funktions‑Erklärungen.
Ganz anders bei Segmenten wie Möbel, Dekor oder Inneneinrichtung. Hier arbeitet der Entscheidungsprozess stärker visuell – Bilder, Haptik und Stil spielen die Hauptrolle. AI Overviews verlieren an Relevanz, und Google zieht sie häufiger ab. Auch das spricht für eine datengetriebene Steuerung: Wo Textinformationen wichtig sind, darf KI mitreden; wo Ästhetik dominiert, spielen klassische Bilder‑ oder Shoppingformate die erste Geige.
Wie Google mit Suchintentionen jongliert
BrightEdge hat die beibehaltenen Keywords genauer untersucht: Rund ein Viertel davon entfällt auf Vergleichs‑ und Bewertungsbegriffe wie „beste …“ oder „X vs Y“. Solche Suchen stehen klar im Zeichen von Lern‑ und Entscheidungsprozessen. Dafür eignen sich strukturierte, erklärende Inhalte, die die KI bequemerweise zitieren oder zusammenfassen kann.
Entfernt wurden dagegen Suchanfragen mit transaktionalem Fokus – „kaufen“, „Preis“, „Rabatt“, „Deal“, aber auch sehr konkrete Produktbezeichnungen. Google signalisiert damit, dass AI Overviews nicht als Conversion‑Tool gedacht sind, sondern als Wissens‑ und Vergleichshelfer. Es ist also besser, wenn du dein Content‑Portfolio so aufteilst, dass informative und kommerzielle Keywords getrennt abgedeckt werden.
Experimentierfreude mit System
Interessant ist auch, wie dynamisch Google mit dem gesamten AIO‑System umgeht. Laut BrightEdge sprang die Abdeckung an einem Tag plötzlich von 9 % auf 26 %, nur um kurz darauf wieder auf das ursprüngliche Niveau zu fallen. Diese Sprünge zeigen, dass in Mountain View ständig getestet und getuned wird. Selbst von Jahr zu Jahr überlappen sich die betroffenen Suchbegriffe nur zu etwa 18 % – ein klares Signal, dass Beständigkeit kein realistisches Szenario ist.
Ich persönlich glaube, dass diese Fluktuation nicht zufällig ist. Google probiert aus, misst Klicks und Verweildauer und zieht daraus Rückschlüsse, wann Nutzer von AI profitieren – und wann nicht. Für Marketer heißt das: Wach bleiben, regelmäßig prüfen, welche Suchanfragen tatsächlich AI‑Overviews zeigen, und schnell reagieren, wenn sich Muster verschieben.
Saisonale Muster: November ist der Schlüsselmonat
Besonders für E‑Commerce‑Marken ist der Jahresrhythmus entscheidend. Die Daten zeichnen ein klares Verlaufsmuster:
November = Recherche, Anfang Dezember = Vergleich, Ende Dezember = Kauf. AI Overviews dominieren also gerade dann, wenn Nutzer Ideen sammeln und Alternativen abwägen.
Für Content‑Verantwortliche heißt das: Spätestens im Oktober sollte der vergleichende Content optimiert und im Index sein, damit er rechtzeitig von der KI erfasst wird. Wer erst im Dezember daran arbeitet, kommt schlicht zu spät – dann haben klassische Produktseiten wieder die Hoheit.
Strategischer Tipp aus der Praxis
Ich empfehle oft, die eigenen Inhaltsformate deutlich zu trennen:
- „Hilft mir entscheiden“‑Inhalte – z. B. Ratgeber, Gegenüberstellungen, „Was ist besser für …“‑Artikel. Diese sind prädestiniert, von AI Overviews aufgegriffen zu werden.
- „Will ich kaufen“‑Inhalte – klare Produktempfehlungen, Preisinformationen, Verfügbarkeiten. Hier geht es um klassische SEO‑Optimierung, strukturierte Daten und starke CTAs.
Was das für Marken bedeutet
Wenn man alles zusammenzählt, ergibt sich ein einfaches Modell:
AI Overviews begleiten den Konsumenten bis zur Schwelle der Kaufabsicht – nicht darüber hinaus. Marken, die diese Bildungs‑ und Vergleichsphase mit hilfreichem Content abdecken, erscheinen häufiger in der KI‑Zusammenfassung. Wer dagegen erst am Ende der Customer Journey aktiv wird, verpasst die Chance, Frühkontakt aufzubauen.
Praktisch gesprochen:
- Sorge dafür, dass deine Vergleichs‑ und Bewertungsseiten technisch sauber und frühzeitig indexiert sind.
- Verwende klare Strukturen – Überschriften, Bulletpoints, definierte Absätze –, damit die KI Inhalte leichter extrahieren kann.
- Verfolge regelmäßig, welche deiner Seiten in AI Overviews auftauchen. Tools und manuelle Checks lohnen sich.
- Plane flexibel: Bei nur 18 % Keyword‑Überschneidung von Jahr zu Jahr darfst du dich nicht auf Bestandslisten verlassen.
Mein Fazit
Auch wenn die Schwankungen der AI‑Einblendung manchmal verwirrend wirken, steckt dahinter ein klares Muster. Google nutzt AI Overviews dort, wo Nutzer lernen und vergleichen – nicht dort, wo sie kaufen. Die besten Chancen entstehen für Inhalte, die erklären, vergleichen, Orientierung schaffen. Kategoriespezifische Unterschiede, saisonale Peaks und fortlaufende Tests gehören inzwischen zum Spiel.
Für dich als Marketer heißt das: Behandle AI Overviews nicht als Bedrohung, sondern als zusätzliche Bühne für dein Fachwissen. Wer im November in der Wissens‑ und Vergleichsphase präsent ist, legt die Grundlage dafür, dass potenzielle Käufer im Dezember genau dich wiederfinden – egal ob über KI, klassische Ergebnisse oder Direkt‑Traffic.
Und ganz ehrlich: Dieses Zusammenspiel aus Mensch, Maschine und Suchintention macht SEO gerade wieder richtig spannend.