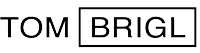Es gibt im SEO-Bereich ein paar Schlagworte, die schon fast wie Naturgesetze wirken, obwohl sie das gar nicht sind. Eines davon ist Keyword‑Cannibalization, also die Angst davor, dass mehrere Seiten einer Domain um denselben Suchbegriff konkurrieren und sich gegenseitig „auffressen“. Viele SEOs fürchten das, weil es einfach klingt: Klar, wenn zwei Seiten für dasselbe Keyword da sind, nimmt sich die eine der anderen den Platz weg. Klingt logisch – ist aber in Wirklichkeit meistens nicht so dramatisch.
Von Google kam dazu eine deutliche Einordnung, und die lohnt sich, weil sie an einer Stelle den Schleier lüftet: Das Problem liegt oft gar nicht im „Cannibalization“-Mythos, sondern in ganz konkreten Schwächen an den Seiten selbst. Genau darauf möchte ich im Folgenden eingehen.
Was steckt wirklich hinter „Keyword Cannibalization“?
Lass uns ehrlich sein: Der Begriff klingt griffig, aber er ist unsauber. Er gibt keine konkrete Analyse, warum eine Seite nicht rankt. Manchmal werden einfach alle möglichen Fälle, in denen Rankings schwach ausfallen, in diese Schublade gesteckt. Das führt dazu, dass viele denken, sie hätten ein Problem mit „Cannibalization“, obwohl es ganz andere Ursachen gibt.
Und ja: Google selbst sagt, mehrere Seiten zum selben Suchbegriff zu sehen, ist kein Problem an sich. Im Gegenteil: es kann sogar ein Vorteil sein, wenn du mit mehr als nur einer Landingpage sichtbar bist, beispielsweise mit einem Ratgeber, einer Produktseite und vielleicht noch einer FAQ-Seite. Die Suchintentionen von Usern sind vielfältig – verschiedene Seiten einer Website können verschiedene Aspekte dieser Intention abdecken.
Wenn also in den SERPs plötzlich drei Seiten deines Projektes auftauchen, solltest du das nicht reflexartig als Gefahr sehen. Ich würde eher sagen: Das ist eine zusätzliche Fläche, die dir Sichtbarkeit bringt. Natürlich solltest du die Qualität dieser Seiten prüfen: Sind sie scharf positioniert, haben sie einen Mehrwert, oder sind es Kopien mit austauschbaren Absätzen?
Wo die eigentlichen Probleme liegen
1. Inhalte ohne Klarheit
Viele Seiten, die angeblich „kannibalisieren“, sind schlicht zu lang und zu unscharf. Du kennst das bestimmt: Ein Autor versucht alles in einen Text zu packen – ein Überblick, eine Guideline, zig Beispiele – und am Ende ist der Artikel ein Mischmasch. Der Effekt? Google versteht nicht, welche Suchintention genau bedient wird. Es fehlt die Fokussierung.
2. Vom Thema abweichende Passagen
Manchmal wird ein Keyword nur angerissen, dann schweift der Text in Nebenaspekte ab, die nichts mit der eigentlichen Suchanfrage zu tun haben. Ergebnis: Der Algorithmus ordnet die Seite nicht klar zu, und sie rutscht im Ranking ab. Das hat nichts mit dem Nebeneinander mehrerer Seiten zu tun – es geht einzig um Qualität und Relevanz.
3. Fehlende interne Verlinkung
Erstaunlich oft stolpere ich über Projekte, bei denen interne Links eher zufällig gesetzt sind. Man klickt sich tot, findet plötzlich hier eine Produktseite, dort einen Ratgeber – ohne System. Wenn Google deine Inhalte nicht sauber in ein Geflecht einordnen kann, gehen die Signale verloren. Dann ranken manche Seiten gar nicht, und das wird schnell als „Cannibalization“ fehlinterpretiert. Das Problem ist in Wahrheit die mangelnde interne Struktur.
4. Dünne Inhalte
Ein ganz einfacher Punkt: Es gibt zu viele dünne Seiten. Seiten, die kaum echten Mehrwert haben, vielleicht automatisch erzeugt oder nur aus ein paar Absätzen bestehen. Die konkurrieren nicht wirklich – sie nerven Google. Hier wird ein Rankingverlust schnell einem falschen Buzzword angelastet, obwohl es ein handfestes Content-Qualitätsproblem ist.
5. Echte Duplikate
Natürlich gibt es auch echte Doppelungen, etwa wenn zwei URLs nahezu identisch sind. Aber das lässt sich technisch aufräumen – per Canonical, per Weiterleitung oder durch das Zusammenführen der Inhalte. Das ist ein konkreter SEO-Job. Aus meiner Sicht ist es besser, hier mit einem sauberen Technical‑Setup zu arbeiten, als sich über „Cannibalization“ den Kopf zu zerbrechen.
Warum viele SEOs am falschen Punkt ansetzen
Ein spannender Gedanke ist für mich, warum der Begriff so populär wurde. Wahrscheinlich, weil er eine einfache Erklärung für komplexe Probleme liefert. Menschen neigen dazu, ein kompliziertes Thema lieber mit einem einfachen Label abzuspeisen. „Cannibalization“ ist dafür perfekt geeignet – man muss nicht tief graben, es klingt nach einem greifbaren Schuldigen.
Aber – und hier liegt der Haken – SEO funktioniert selten so simpel. Rankings hängen von Nutzerintentionen, Content-Qualität, interner Struktur, Backlinks, Domain-Stärke und zig weiteren Faktoren ab. Ein einziges Label wie „Cannibalization“ verschleiert oft mehr, als es klärt.
Nicht selten ist es hilfreicher, die Perspektive zu wechseln: Frag dich nicht, ob Seiten sich gegenseitig blockieren, sondern ob jede Seite ihren Job für den Nutzer erfüllt. Liefert sie die Antwort, die hinter der Suchanfrage steckt? Ist sie schnell erreichbar? Ist sie eingebettet in den Rest deiner Website?
Praktische Konsequenzen für dich
Falls du konkret vor dem Dilemma stehst, dass zwei Seiten zu demselben Keyword auftauchen, hier ein paar Ansätze, wie ich selbst vorgehen würde:
- Analysiere die Intention: Schaue dir die SERPs an und prüfe, ob unterschiedliche Seitentypen dort Erfolg haben. Wenn ja, ist es normal, dass deine Inhalte mehrfach erscheinen.
- Sichtung auf Klarheit: Stelle sicher, dass jede Seite eine eindeutige Primärintention verfolgt. Trenne Informationen, die zu breit gestreut wurden.
- Interne Links nachjustieren: Leite deine Nutzer (und Google) sauber durch den Content. Wichtigste Seite zuerst, flankierende Seiten unterstützend.
- Mist radikal löschen: Dünne oder doppelte Inhalte, die keinerlei Traffic oder Engagement leisten, sind Kandidaten zum Zusammenfassen oder Entfernen.
Ich habe schon erlebt, dass eine einzige aufgeräumte Page plötzlich mehr Sichtbarkeit erzeugt als zuvor fünf Halbstarke. Gleichzeitig gibt es auch Szenarien, wo zwei verschiedene Seiten parallel hervorragend abschneiden, weil sie unterschiedliche Segmente der Nachfrage bedienen. Das ist völlig normal.
Mein persönliches Fazit
Je länger ich diese Diskussionen verfolge, desto klarer wird mir: Keyword‑Cannibalization ist mehr ein psychologischer SEO-Mythos als ein reales Problem. Es lenkt oft nur davon ab, was wirklich zählt – nämlich großartige, fokussierte Inhalte und eine durchdachte interne Architektur.
Wenn also bei dir mehrere Seiten auf dasselbe Keyword ranken: Glückwunsch, du hast gleich mehrere Pfeile im Köcher. Denke lieber darüber nach, ob sie sauber positioniert sind, ob sie sich gegenseitig stärken und ob sie den Nutzer glücklich machen. Dann brauchst du keine Angst vor diesem bunten Buzzword zu haben.
Und ganz ehrlich: Wenn man das mit einem Augenzwinkern betrachtet – stell dir vor, die Suchmaschine liebt Käse (wie im Beispiel genannt). Dann tauchen mehrere Seiten dazu auf: Rezepte, Shops, Messer, Tipps, Kombinationen mit Ananas. Jeder Treffer hat seine Berechtigung. Solange du nicht fünfmal denselben Käse aufwärmst, sondern unterschiedliche Varianten präsentierst, wirst du damit Vorteile haben.
Am Ende verschwindet das Gespenst „Cannibalization“ in dem Moment, in dem du genauer hinschaust. Und was bleibt, sind reale SEO-Hausaufgaben: Fokus, Qualität, Struktur.