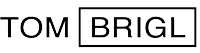In den vergangenen Jahren hat sich die Art, wie wir Informationen suchen und konsumieren, rasant verändert. Künstliche Intelligenz (KI) ist dabei der Treiber eines Wandels, der das gesamte Suchökosystem neu formt – und mit ihm die Arbeit von Marketingleitern, Kommunikationsstrategen und SEO-Profis. Was früher eine klare Kette aus Suchanfrage, Ergebnis und Klick war, ist heute ein vielschichtiges, vielfach zersplittertes Netz aus Antworten, Empfehlungen, visuellen Impulsen und automatisierten Entscheidungspfaden.
Aus meiner beruflichen Erfahrung muss ich sagen: Es fühlt sich schon fast an, als stünden wir an einem ähnlichen Punkt wie damals, als mobile Geräte die Desktopwelt auf den Kopf gestellt haben. Nur diesmal ist der Wandel tiefer – und schneller. Die zentralen Fragen lauten heute: Was bedeutet Sichtbarkeit in einer von KI gesteuerten Welt? Wie misst man Erfolg, wenn klassische Kennzahlen wie „Ranking“ oder „Traffic“ an Bedeutung verlieren? Und wie kann man als Führungskraft sein Unternehmen durch diese Veränderung steuern, ohne in hektischen Reaktionen zu verharren?
Warum sich Suchverhalten so stark verändert
Zwei große Kräfte wirken gleichzeitig: technologische Fortschritte und neue Verhaltensmuster, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen. Seit der Einführung von ChatGPT und ähnlichen Tools ist KI kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil des Alltags. Menschen suchen heute nicht nur über Google, sondern über Sprachassistenten, Chatbots, smarte Brillen oder soziale Netzwerke. Sie kreisen mit dem Finger etwas auf dem Smartphone ein („Circle to Search“), fotografieren Objekte mit Google Lens oder stellen einfach eine komplexe Frage an ein KI-Modell.
Diese Tools kombinieren Text, Bild, Ton und Kontext. Sie lernen, was wir meinen – nicht nur, was wir eintippen. Das verändert die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine grundlegend. Besonders spannend finde ich, dass jüngere Nutzer diese Tools intuitiv verinnerlichen: Sie geben nicht mehr Suchbegriffe ein, sondern suchen Erlebnisse, Empfehlungen oder Inspiration. Das Suchergebnis ist keine Liste von Links, sondern ein multiperspektivisches Antwortfeld.
Von der klassischen Suchanfrage zur KI-Erfahrung
Suchmaschinen wie Google oder Bing entwickeln sich zu Antwortmotoren, die Inhalte aus zahllosen Quellen aggregieren. ChatGPT, Perplexity oder Gemini liefern komplette Zusammenfassungen und Handlungsempfehlungen. Für uns als Marketer bedeutet das: Sichtbarkeit findet nicht mehr ausschließlich auf der eigenen Website statt, sondern auf fremden Plattformen, in KI-generierten Snippets und innerhalb multimodaler Interfaces.
Diese Entwicklung führt unweigerlich zu einem „dunklen Trichter“: Die Nutzer durchlaufen ihre Kauf- oder Recherchephase teilweise unsichtbar. Sie sehen unsere Marke vielleicht erwähnt in einem KI-Output oder in einem Forenbeitrag, treffen aber Entscheidungen, bevor sie überhaupt auf unsere Website kommen. Klassische Tracking-Modelle greifen hier oft ins Leere – und das erzeugt Unsicherheit in den Chefetagen, die gewohnt sind, Ergebnisse in klaren Zahlen zu sehen.
Das Ende der alten Metriken
Früher galt: Wer in den Top 3 bei Google rankt, gewinnt. Heute ist das zu kurz gedacht. Die Präsenz in einer KI-Antwort kann genauso wertvoll sein wie ein organisches Ranking. Dabei entstehen neue Arten von Sichtbarkeit – man wird zitiert, empfohlen oder abgebildet, ohne dass zwingend ein Klick erfolgt.
Das heißt: Wir müssen die Erfolgsmessung neu aufsetzen. Statt nur Positionen zu bewerten, geht es um Themenautorität, Markenpräsenz über mehrere Kanäle hinweg und den Beitrag von SEO zum Gesamterlebnis. Hier helfen Werkzeuge wie Google Analytics 4, um sogenannte „Cross-Channel-Lifts“ zu erfassen: Wie viele Erstkontakte stammen aus organischer Suche, auch wenn der Abschluss später über Social Media oder Paid-Kampagnen erfolgt?
Ebenso wichtig sind neue Kennzahlen, etwa die Sichtbarkeit unserer Inhalte innerhalb von KI-Ausgaben oder die thematische Reichweite. Der Übergang von keywordbasierter Optimierung zu semantischer Themenabdeckung ist in vollem Gange – und wer das versteht, kann seinen Content strategischer ausrichten.
Die neue Rolle der Führung
Was bedeutet all das für dich als Entscheider? Im Grunde, dass du nicht länger nur Kampagnen steuerst, sondern ein System von Orientierung. Du musst verstehen, wo eure Marke heute sichtbar ist – und wo sie unsichtbar bleibt. Dafür braucht es fünf grundlegende Schritte, die ich in etlichen Projekten wiedererkenne.
1. Analysiere deinen KI-Traffic
Auch wenn der Anteil derzeit noch überschaubar ist, taucht KI-vermittelte Nutzung zunehmend in Analytics-Daten auf. Du kannst mit cleveren Filtern (beispielsweise Regex) Plattformen wie Copilot, ChatGPT oder Gemini isolieren und separat auswerten. So erkennst du, welche Seiten, Themen oder Formate von KI-Tools besonders häufig gezogen werden.
Im Top-Management entsteht dadurch erstmals ein Gefühl dafür, dass KI kein abstraktes Experiment ist, sondern bereits Einfluss auf Nutzerströme und Umsätze hat. Sichtbar gemachte Daten sind die Grundlage, um Budgets sinnvoll zu verschieben – weg von Marketingtaktik, hin zu strategischer Anpassung.
2. Denke in Märkten, nicht in Metriken
Ein abnehmender Traffic bedeutet nicht zwangsläufig ein schlechtes SEO. Er kann schlicht das Ergebnis eines schrumpfenden Marktes innerhalb klassischer Suchmaschinen sein. Vergleiche daher organische und bezahlte Impressionen für identische Suchanfragen: Wenn beide sinken, ist das ein Signal für verändertes Nutzerverhalten – nicht für schlechte Ausführung.
Ich habe es oft erlebt, dass Teams wegen rückläufiger Zahlen in Panik geraten, obwohl sie in Wahrheit einem größeren Trend folgen. Führungskräfte, die diese Dynamik verstehen, kommunizieren differenzierter – und schaffen Vertrauen statt Krisenstimmung.
3. Entwickle Sichtbarkeit außerhalb deiner Website
KI greift zunehmend auf externe Websites, Bewertungsplattformen, Reddit-Threads oder Branchenverzeichnisse zu, um ihre Antworten zu generieren. Deshalb gehört es heute zur Pflicht, nicht nur die eigene Domain zu optimieren, sondern Teil dieses Ökosystems zu werden.
Das bedeutet: Erwähnungen in Fachartikeln, Listicles, Communities oder Produktbewertungen zählen doppelt – für Menschen und für Maschinen. Sichtbarkeit ist kein Besitz mehr, sie ist verteilt. Umso wichtiger ist die Pflege vertrauenswürdiger Signale über viele Kanäle hinweg.
4. Denke den Funnel neu
Der klassische Marketingtrichter – Bewusstsein, Erwägung, Entscheidung – ist heute kaum noch linear. Nutzer springen zwischen Plattformen, Medien und Tools hin und her. Eine Produktsuche kann als Bildrecherche beginnen, über KI‑Empfehlungen weiterlaufen und auf Social Media enden.
Analysiere, wo KI-Interaktionen deine Journey überlagern oder unterbrechen. Dort musst du Wege finden, wieder Anschluss zu gewinnen – sei es durch Partnerschaften, Micro‑Influencer oder sinnvolle Paid-Kooperationen.
Ich spreche gern vom „Patchwork-Funnel“ – ein Mosaik aus Kontaktpunkten, das du ständig neu zusammensetzen musst.
5. Messe den indirekten Wert
SEO wirkt oft als erster Impuls, nicht als Abschluss. Wenn du nur nach Last‑Click‑Conversions bewertest, wirfst du den größten Teil des Wertes weg. Nutze Tools wie GA4, um Erstkontakt-Sessions zu identifizieren, die später über andere Kanäle konvertieren.
So kannst du zeigen, dass Markensichtbarkeit in Such- oder KI-Ökosystemen auch dann Umsatztreiber ist, wenn der Kauf nicht direkt nach dem Klick erfolgt. Diese Beweisführung stärkt den strategischen Stellenwert von organischer Präsenz enorm – und öffnet Türen zu höheren Budgets.
Vom Reagieren zum Führen
All diese Empfehlungen zielen auf dasselbe Ziel: aus der Reaktionsspirale auszubrechen. KI-getriebene Plattformen verändern sich ständig; du kannst sie nicht kontrollieren, aber du kannst verstehen, wie sie funktionieren. Führung in dieser Ära heißt, flexible Systeme aufzubauen – Teams, die kontinuierlich lernen, testen, analysieren und anpassen.
Ein Beispiel aus meiner Praxis: In einem internationalen Projekt begannen wir, wöchentlich kleine „Signalberichte“ zu erstellen. Darin erfassen wir Hinweise auf neue KI-Zitate, sich ändernde Antwortmuster und Nutzerfragen. Diese Mini-Reports waren Gold wert, weil sie uns halfen, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen – bevor es jemand anderes bemerkte.