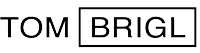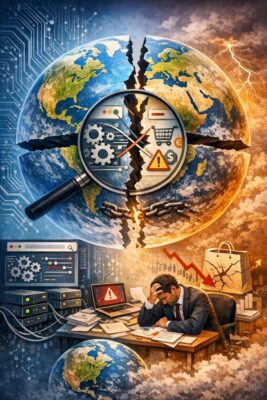Wie sichtbar bist du eigentlich für Künstliche Intelligenzen? Diese Frage haben sich viele in letzter Zeit gestellt – und plötzlich tauchen überall Tools auf, die genau das versprechen: sogenannte LLM Visibility Tracker. Sie sollen verraten, ob und wie oft große Sprachmodelle wie ChatGPT oder Google Gemini Marken, Produkte oder Inhalte erwähnen. Aber lohnt sich das wirklich? Ich habe mir das genauer angesehen – und ja, manches überrascht sogar mich.
Verstehen, warum LLM-Sichtbarkeit überhaupt ein Thema ist
Zuerst musst du wissen, dass nicht jede Marke gleich stark von LLMs beeinflusst wird. Für manche Unternehmen – etwa solche, die digitale Tools oder datengetriebene Produkte anbieten – kann künstliche Intelligenz ein echter Traffic-Booster sein. Andere stoßen hier an ihre Grenzen, weil ihre Zielgruppe noch ganz woanders unterwegs ist.
Ein Beispiel: Eine Softwarefirma wie Ahrefs hat veröffentlicht, dass rund zwölf Prozent ihrer neuen Kund*innen über KI-Suchsysteme kamen – obwohl diese nur einen winzigen Bruchteil ihres Gesamttraffics ausmachen. Das klingt nach einem goldenen Kanal. Doch bei vielen anderen, vor allem klassischen Publishern oder Marken im E-Commerce, bleibt der Effekt minimal.
Ich habe bei mir ähnliche Beobachtungen gemacht: Wenn du ein breites Informationsangebot betreibst, bringt dir „KI-Traffic“ in der Regel weniger qualifizierte Nutzer*innen. Oft klicken sie einmal, lesen ein bisschen – und verschwinden. Dafür lohnt sich kaum ein teures Trackingsystem.
Was genau machen diese Tracker eigentlich?
Tools wie Profound, Ahrefs Brand Radar oder neuere Produkte von Similarweb analysieren, wie KI-Systeme auf Anfragen reagieren. Sie führen dieselben Prompts – also Suchanfragen – Hunderte Male aus, beobachten, welche Marken oder Quellen genannt werden, und berechnen daraus Werte wie „Visibility“ oder „Citation Score“.
Da die Antworten von Chatbots variieren (je nach sogenannter Temperatur, also Zufallsgrad), braucht man Durchschnittswerte. Stell dir vor, du würdest dieselbe Frage hundertmal stellen. Wird dein Unternehmen siebzigmal erwähnt und siebenmal sogar verlinkt, bekommst du 70 % Sichtbarkeit und 7 % Zitationsrate.
In der Praxis hilft das, grob abzuschätzen, ob deine Marke in einem Themenfeld präsent ist. Aber perfekt ist das nie. Die Ergebnisse schwanken, und insbesondere OpenAI oder Anthropic aktualisieren ihre Modelle ständig – also fließen neue Daten ein oder alte fallen weg. So kann deine Sichtbarkeit innerhalb weniger Wochen stark sinken oder steigen, ohne dass du irgendetwas getan hast.
Ich finde: Du solltest so ein Tool immer mit Skepsis nutzen. Es liefert Tendenzen, keine Wahrheiten.
Wie arbeiten diese Tracker technisch?
Im Kern gibt es zwei Varianten:
1. Du definierst selbst Themen und Prompts, die regelmäßig abgefragt werden – das ist die günstigere Variante.
2. Du nutzt Enterprise-Systeme, die ein riesiges Set vordefinierter Prompts laufen lassen und dadurch einen Gesamtmarkt abbilden.
Die erste Variante eignet sich, wenn du ganz bestimmte Nischen beobachtest. Die zweite ist dann sinnvoll, wenn du wirklich wissen willst, wie dein Marktumfeld in der KI-Welt wahrgenommen wird.
Spannend wird’s bei den neuen Modellen, die reale Nutzerdaten aus Klick-Streams einbeziehen. Damit kannst du endlich nachvollziehen, wie echte Menschen LLMs verwenden und welche Fragen sie wirklich stellen. Synthetic Prompts – also künstlich erzeugte Abfragen – sind dagegen oft theoretisch und spiegeln das Verhalten echter Nutzer*innen kaum wider.
Das große Problem: Was misst LLM-Sichtbarkeit überhaupt?
Ich sehe hier zwei Ebenen. Einerseits signalisiert eine Erwähnung, dass deine Marke „im Gespräch“ ist. Andererseits sagt das noch nichts darüber aus, ob dieser Traffic – falls er überhaupt kommt – konvertiert.
Und da liegt der Haken. Die meisten KI-Systeme wollen gar keinen Link-Traffic erzeugen. Sie beantworten Fragen direkt im Chatfenster. Im besten Fall zeigen sie Quellenverweise, im schlechtesten verschwinden deine Inhalte komplett im grauen Rauschen.
Wenn du also Geld in einen Visibility Tracker steckst, musst du dich fragen: Will ich wissen, ob ich erwähnt werde – oder will ich Kunden? Denn selbst wenn du das erste erreichst, folgt daraus noch lange nicht das zweite.
Hinzu kommt eine andere Dynamik: Die Monetarisierung dieser KI-Plattformen wird kommen – und zwar schnell. Sobald OpenAI, Anthropic oder Google Wege finden, direkt in ihren Interfaces Werbung zu schalten oder Empfehlungen zu verkaufen, wird organische Reichweite weiter zurückgedrängt. So war es bei Social Media, so war es bei klassischen Suchmaschinen. Warum sollte es diesmal anders sein?
Was bringen dir diese Daten trotzdem?
Selbst wenn die reinen Sichtbarkeitsdaten instabil sind, steckt darin ein anderes großes Potenzial: Sentiment-Analyse. Die Tools zeigen, welche Stimmungen zu deiner Marke kursieren, welche Plattformen zitiert werden (meist Reddit, Trustpilot, Fachforen) und welche Themen besonders positiv oder negativ besprochen werden.
Das kannst du nutzen, um Kommunikationsstrategien zu schärfen. Vielleicht stellen die Modelle dein Produkt auf Basis veralteter Reviews falsch dar – dann ist es Zeit, mit klarer Produktkommunikation dagegenzuhalten. Vielleicht tauchen Beschwerden über Kundenservice oder Kündigungsprozesse auf – Hinweise, dass du hier nacharbeiten musst.
Ich mag diesen Teil besonders, weil er weit über SEO hinausgeht. Wenn du dein Unternehmen ganzheitlich verstehst, ist das Gold wert. Suchmaschinenoptimierung ist nur ein Baustein innerhalb deines Markenrufs. Korrekte Informationen und gute Bewertungen heben deine gesamte Brand-Experience.
Kurz gesagt: Nutze LLM-Tracking nicht in erster Linie, um SEO zu pushen, sondern um zu verstehen, wie die digitale Öffentlichkeit dich sieht.
Kannst du das selbst bauen?
Ja, theoretisch schon. So ein System ist technisch gar nicht so kompliziert, wenn du keine Angst vor API-Arbeit und Python hast. Du brauchst:
– Zugang zu den LLM-APIs (z. B. OpenAI GPT, Gemini, Claude 3),
– ein einfaches Skript, das deine Prompts regelmäßig anfragt,
– eine Datenbank (z. B. Supabase oder Airtable), um die Ergebnisse zu speichern,
– und ein Dashboard, um daraus Diagramme zu bauen (z. B. mit Streamlit oder Lovable).
Bei konservativer Nutzung liegen die API-Kosten ungefähr bei 20–30 Dollar im Monat, dazu Hosting und Speicher vielleicht weitere 50 Dollar. In Summe also unter 100 Dollar – und du hast dein persönliches Tracking-System. Es ist natürlich kein vollwertiges Enterprise‑Tool, aber perfekt, um zu lernen, wie deine Marke in KI-Modellen erwähnt wird.
Aus meiner Erfahrung lohnt sich der Selbstbau besonders für Agenturen oder Tech-affine Marketer. Du lernst viel über Prompt-Design, Sampling und Datenbereinigung. Und du bleibst flexibel: Wenn eine Plattform morgen ihre API-Preise verdoppelt oder ihr Modell schließt, kannst du schnell umstellen.
Wenn du dich entscheidest zu investieren
Bevor du Geld ausgibst, prüfe ein paar Dinge:
– **Relevanz:** Kommt nennenswerter Umsatz über KI-generierte Empfehlungen? Wenn nicht, ruhig bleiben.
– **Preis-Leistung:** Viele Tools bieten Testphasen. Nutze sie, analysiere ein oder zwei Monate lang, und entscheide dann.
– **Team-Kompetenz:** Wer wertet die Daten aus? Wenn du niemanden hast, der die Zahlen interpretiert, hilft dir auch das beste Dashboard nichts.
– **Erweiterbarer Nutzen:** Lassen sich die Daten ins Reputation‑ oder Brand‑Management integrieren? Je mehr Abteilungen davon profitieren, desto eher lohnt sich die Investition.
Mir persönlich gefallen Tracker am besten, die qualitative Einsichten statt reiner Zahlen liefern – also Tools, die sentimentbezogene Texte zeigen oder dir gleich konkrete Quellen nennen. Zahlen alleine verführen sonst zu vorschnellen Schlüssen.
Was du sonst noch beachten solltest
Viele Verantwortliche versuchen derzeit, „LLM‑Optimierung“ als neue Disziplin zu definieren – analog zur SEO. Ich bin da skeptisch. Die Mechanismen der KI-Antwortsysteme ändern sich zu oft, um stabile Ranking-Strategien zu etablieren. Was heute funktioniert, kann in drei Monaten tot sein.
Was aber bleibt, ist das Bedürfnis der Modelle nach vertrauenswürdigen Informationen. Und das erreichst du nicht mit Tricks, sondern mit echter Relevanz: gut strukturierte Inhalte, klare Markenbotschaften, geprüfte Daten. Wenn dein Produkt oder deine Inhalte echten Mehrwert bieten, wirst du langfristig automatisch öfter referenziert – ob in Chatbots, Suchmaschinen oder durch Menschen.
Kurzum: Auch im Zeitalter der KI gilt: Erst für Menschen optimieren, dann für Maschinen.
Mein persönliches Fazit
Wenn du Budget hast und LLMs eine nachweisbare Rolle in deiner Customer Journey spielen, probiere einen Tracker ruhig aus – aber mit klarer Fragestellung. Willst du herausfinden, wie positiv Nutzer*innen über dich sprechen? Oder ob du überhaupt im KI-Gespräch vorkommst? Schon zwei Monate Testlauf können aufschlussreich sein.
Wenn du knappe Budgets hast oder keinen direkten ROI erkennst, lass es sein. Baue lieber an deinen Inhalten, Pflege deiner Community und Reputationsarbeit. Das hat bewiesenermaßen langfristigen Wert.
Mein Rat: Nutze LLM‑Daten, um Menschen besser zu verstehen, nicht um Maschinen zu beeindrucken. Sichtbarkeit ist schön – Vertrauen ist wertvoller.
Am Ende hängt alles davon ab, wie du digital glaubwürdig bleibst. KI‑Tracker können ein nützliches Werkzeug sein, aber sie ersetzen kein gutes Produkt, keine ehrliche Kommunikation und schon gar kein Verständnis für deine Zielgruppe. Wenn du das verinnerlichst, brauchst du wahrscheinlich weniger Tools – und bekommst trotzdem mehr Sichtbarkeit, bei Mensch und Maschine gleichermaßen.